Warum begegnen wir der Klimakrise nicht angemessen?
- Link abrufen
- X
- Andere Apps
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine realistischen Antworten habe.
Hier ein Artikel dazu:
https://www.zeit.de/2022/46/klimakrise-kapitalismus-oel-gas-co2/komplettansicht
Klimakrise und Kapitalismus: Warum reagieren wir zu langsam auf den Klimawandel?

Warum reagieren wir zu langsam auf den Klimawandel?
Die Notlage ist offensichtlich: Die Klimakrise ist seit mindestens 50 Jahren bekannt, ohne dass Maßnahmen getroffen worden wären, die die Welt vom Kurs auf eine erhebliche Klimaerwärmung abgebracht hätten. Im Gegenteil: Der weltweite CO₂-Ausstoß hat sich seit 1990 um 50 Prozent erhöht.
Weshalb tun sich Gesellschaften so schwer, auf die Bedrohung eine angemessene Antwort zu finden? Meine Antwort als Sozialwissenschaftler lautet kurz: Moderne kapitalistische Gesellschaften setzen Anreize und weisen Machtstrukturen auf, die die Lösung des globalen Kollektivgut-Problems Klimawandel unmöglich machen, und zwar in der Wirtschaft wie im Staat wie sozial. Man kann die Klimakrise mit guten Gründen als "wicked problem" bezeichnen, als ein Problem, zu dem es keine Lösung gibt: Denn die Klimakrise ist innerhalb der Strukturen von Gesellschaften, die kapitalistisch, demokratisch und konsumistisch verfasst sind, unlösbar.
Erst wenn man sich diesen Zusammenhang im Einzelnen vor Augen führt, lässt sich jedoch auch ermessen, welches Handeln, welche Hebel vielleicht das Schlimmste noch abwenden können. Denn es bleibt moralisch begründbar, zu handeln. Es bleibt die Hoffnung, dass Klimaveränderungen hinausgezögert und zumindest die verheerendsten Szenarios abgewendet werden können. Hieraus ergibt sich eine Rationalität und auch eine moralische Pflicht zum Engagement.
Warum zögert die Wirtschaft? Kapitalistische Märkte haben keinen eingebauten Mechanismus der Berücksichtigung ökologischer Schäden. Zu deren Begrenzung muss von außen auf das Wirtschaftssystem eingewirkt werden: ob durch Umweltschutzauflagen, politisch geschaffene Quasimärkte oder durch ein verändertes Verhalten der Verbraucher. Dies gelingt nicht schnell genug. Denn es verursacht Kosten, die Unternehmen mit Macht zu verhindern, zu verzögern, zu verwässern versuchen. Am kostengünstigsten ist es, Wandel lediglich zu behaupten, um Zeit zu schinden. Zu solchen Strategien gehört die immer häufigere Propagierung von Plänen veränderten Verhaltens in der Zukunft.
Die Macht von Unternehmen lässt sich am Beispiel der Öl- und Gasindustrie beschreiben, des vermutlich machtvollsten globalen Wirtschaftszweigs. Er hat ein globales Umsatzvolumen von etwa fünf Billionen Euro, was circa fünf Prozent der weltweiten Wertschöpfung entspricht. Im Durchschnitt der letzten 50 Jahre entstanden in dieser Industrie jedes Jahr Gewinne in Höhe von einer Billion Dollar. Allein die fünf größten westlichen Ölkonzerne gaben 2019 gemeinsam 200 Millionen Dollar für Lobbyismus aus, um das Geschäftsmodell fossiler Energie zu verteidigen. Es setzt sich in den nachgelagerten Industrien fort. Die Politik kann, selbst wenn sie dies wollte, nicht einfach gegen die Macht dieser Unternehmen "durchgreifen". Für Steuereinnahmen ist der Staat auf Wachstum und privatwirtschaftliche Investitionen angewiesen.
An der Dominanz fossiler Energie ändert auch die Expansion der Märkte für erneuerbare Energien nur bedingt etwas. Diese Märkte sind seit 20 Jahren enorm gewachsen. Doch wuchsen im letzten Jahrzehnt Öl-, Gas- und Kohleproduktion weiter, und es wurde mehr Geld für die Infrastruktur dieser fossilen Energieträger ausgegeben als für erneuerbare Energien. In einer Welt mit steigendem Energiebedarf werden bis heute nicht weniger, sondern mehr Öl, Gas und Kohle verfeuert.
Der Soziologe Niklas Luhmann hat in den 1980er-Jahren trocken formuliert, das Wirtschaftssystem verstehe nur die Sprache der Preise, alles andere bleibe Rauschen. Um ökonomisch Resonanz zu erzeugen, muss Naturzerstörung deshalb von außen einen Preis bekommen. Dies kann durch CO₂-Besteuerung oder die Veränderung des Verbraucherverhaltens geschehen. Aber wie effektiv sind diese beiden Hebel?
Ökonomen haben das Instrument der CO₂-Zertifikate erfunden, mit dem Verschmutzung bepreist wird. Die Zertifikate sind in ihrer Steuerung aber langsam, unpräzise und unvollständig. Denn gelenkt wird nicht die Investition in bestimmte neue Technologien, dies wird vielmehr dem Markt überlassen. Gleiches gilt für de-risking-Strategien im Finanzsektor, die Kapital von klimaschädlicher Produktion abziehen, das Weitere aber den privaten Investoren überlassen. Um Klimaneutralität zu erreichen, müssten die Zertifikate global ausgegeben werden und sämtliche Emissionen erfassen. Dies wird aus politischen Gründen nicht geschehen. Nicht nur wegen der Macht der Unternehmen, sondern auch aufgrund politischer Widerstände. Denn CO₂-Zertifikate und CO₂-Importsteuern wirken wie die Umsatzsteuer als Konsumsteuer und belasten besonders untere Einkommensschichten.
Je reicher Gesellschaften sind, desto mehr CO₂ emittieren sie
Die Veränderung des Verbraucherverhaltens ist ein zweiter Mechanismus, um Märkte ökologisch zu steuern. Wenn Konsumenten bereit sind, mehr zu bezahlen, kann etwa ein Markt für Biolebensmittel entstehen. Das Gleiche gilt für Finanzmärkte, wenn Investoren "grüne Finanzinvestitionen" nachfragen. Doch ist eine solche Moralisierung der Märkte bisher wenig effektiv: Zwar gibt es Menschen, die ihren Konsum an ökologische Erfordernisse anpassen. Studien zeigen aber die Diskrepanz zwischen dem Anspruch und dem tatsächlichen Handeln. Der Markt für ethisch produzierte Kleidung bekommt zwar viel öffentliche Aufmerksamkeit, umfasst aber nicht mehr als 0,4 Prozent des globalen Bekleidungsmarkts. Grüne Finanzinvestitionen bilden lediglich vier Prozent des globalen Finanzmarktes.
Hinzu kommt die mangelnde Transparenz dieser Märkte. Was ist eine nach ethischen Maßgaben produzierte Jeans? Wann ist eine Finanzanlage nachhaltig? Skandale um das sogenannte Greenwashing zeigen auch: Für die Nachfrageseite ist nicht erkennbar, was an weit entfernt liegenden Enden von Lieferketten tatsächlich geschieht. Eine Veränderung klimazerstörender Produktionsweisen ist durch ein den Individuen aufgebürdetes ethisches Konsumverhalten am Markt nicht zu erreichen.
Und warum zögert der Staat? Die Politik handelt nur unzureichend, weil das Errichten klimaverträglicher Infrastrukturen erhebliche politische Kosten erzeugt. Trockengelegte Moore müssten renaturiert werden, Überschwemmungsflächen ausgewiesen, Tierhaltungen eingeschränkt – doch wie lassen sich die Konflikte mit den Landwirten politisch lösen? Städte müssten ihr Wachstum begrenzen, um Bodenversiegelung zu reduzieren, ihre Flächen müssten begrünt werden, um Hitzeentwicklung im Sommer zu verringern, und sie müssten ein anderes Wassermanagement einführen – doch wie lässt sich dies mit den Wachstumszielen von Städten vereinbaren? Die Industrie müsste ihre Energieversorgung neu ausrichten. Die Umstellung der deutschen Stahlindustrie auf Wasserstoff soll 30 Milliarden Euro kosten, dazu wird mit dauerhaft 30 bis 40 Prozent höheren Produktionskosten gegenüber der Stahlherstellung mit Koks gerechnet. Um diese Industrie in Deutschland zu halten, sind milliardenschwere Subventionen nötig – doch wie erklärt man der Bevölkerung, weshalb man öffentliches Geld so investieren sollte?
Politische Steuerung stößt auch an kulturelle Grenzen: In einer individualisierten Kultur lassen sich Gebote der Mäßigung nicht durchsetzen. Populistische Bewegungen, die gesunkene Bindekraft politischer Parteien und die in den sozialen Medien massenhaft verbreiteten Falschnachrichten tun ein Übriges: Sie lassen die Steuerungsfähigkeit von Gesellschaften prekär werden. Einem System, das auf die Massenloyalität der Bevölkerung in Wahlen angewiesen ist, läuft die Zeit davon. Angesichts ihrer beschränkten Handlungsfähigkeit wählen auch Staaten die Strategie der Versprechungen, um Klimaschutz vorzutäuschen.
Aber das Handeln unterbleibt nicht nur in Europa: Von den 187 Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens ist derzeit kein einziger auf dem Weg zur Einhaltung des in Paris vereinbarten 1,5-Grad-Ziels. Wie gut auch immer die Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen im globalen Norden gelingt, die weltweiten Emissionen steigen weiter. Paradoxerweise könnte hierzu die Energiewende in den hoch industrialisierten Ländern noch zusätzlich beitragen. Wenn die verringerte Nachfrage im globalen Norden fossile Energie auf dem Weltmarkt preiswerter macht, werden die Länder des Südens vermehrt darauf zugreifen.
Das reichste Zehntel der Weltbevölkerung verursacht nach Angaben des Weltklimarat-Reports von 2022 zwischen 36 und 45 Prozent der weltweiten Emissionen. Je reicher Gesellschaften sind, desto mehr CO₂ emittieren sie. Globaler Klimaschutz setzt unausgesprochen voraus, dass großen Teilen der Weltbevölkerung eigener Wohlstand verweigert wird. Damit wird das zentrale Entwicklungsversprechen der Nachkriegszeit, dass alle Länder zum westlichen Wohlstandsniveau aufholen würden, zu Grabe getragen. Da sich die Länder ihren Verbleib in Armut nicht vorschreiben lassen und die Industrieländer selbst nicht auf eine no growth-Strategie umsteigen oder die Länder des Südens für den Schutz ihrer natürlichen Ressourcen hinreichend entschädigen, werden die CO₂-Emissionen weiter steigen.
Und warum zögert das Staatsvolk? Überall droht eine Absenkung des Lebensstandards. Die Verlustangst ist an der Macht. Umweltzerstörung wird in Meinungsumfragen zwar als herausragendes Problem anerkannt. Doch ist die Bevölkerung nur beschränkt bereit oder in der Lage, die Kosten in Form höherer Preise oder höherer Steuern zu übernehmen. Der unbestreitbare langfristige Nutzen von Klimaschutz bleibt unerfahrbar, und grünes Wachstum bleibt unterfinanziert.
Wenn es um die Kosten von Regulation geht – also etwa höhere Benzinpreise oder Pflichten zur energetischen Sanierung von Häusern –, so ist die Zustimmung bestenfalls geteilt. Gleiches gilt für Einschränkungen im Konsumverhalten. Der Fleischkonsum geht marginal zurück. Würden die Umweltkosten des Fleischkonsums eingepreist, müsste Rindfleisch pro Kilogramm fast zehn Euro teurer werden. Würden klimabezogene Importsteuern auf eingeführte Konsumgüter erhoben, so käme es ebenfalls zu erheblichen Preissteigerungen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Entwicklung nachhaltiger Märkte nur langsam vorankommt. Beschränkung steht im Widerspruch zu einem ökonomischen System, das auf Konsum als Motor baut, und einem politischen System, das den Konsum der Bevölkerung als Steuergrundlage benötigt.
Was gewinnt die Gesellschaft durch den Erhalt der Umwelt?
Doch was heißt das nun für die Spielräume, die verbleiben? Wer in der Klimakrise handeln will, muss sich auf die Frage konzentrieren, wie die Prozesse beeinflusst werden können, die den Umgang mit Natur bestimmen. Hierfür ist das Wissen der Sozialwissenschaften bedeutsam. Welche Hebel bestehen, mit denen Wirtschaft, Staat und Gesellschaft dahin gedrängt werden können, den Erhalt der Lebensgrundlagen stärker zu berücksichtigen und so zumindest einen geringeren Temperaturanstieg zu erreichen? Drei Ansatzpunkte möchte ich nennen.
Erstens: Gesellschaften verfügen über moralische Ressourcen. Menschen setzen sich in ihrem Nahbereich für Regeln und Handlungsweisen ein, auch wenn sie wissen, dass dies mit Kosten verbunden ist und es Trittbrettfahrer gibt. Sie tun das Richtige. Ein solches moralisches Ökosystem gilt es zu stärken. Es stützt die Handlungen der Individuen und übt einen sittlichen Druck auf weitere Mitglieder der Gesellschaft und auf Organisationen aus.
So können widerstandsfähige Überzeugungen entstehen, die sich als soziale Bewegungen artikulieren, ob in lokalen Initiativen zum Stopp des Kohleabbaus, in Klimastreiks oder in Initiativen zum Stopp der Abholzung des Regenwaldes. Dieses Handeln mag unzureichend sein. Doch solche Initiativen können kognitive Rahmungen in der Gesellschaft beeinflussen und damit Effekte haben, die vielleicht größere Veränderungen hervorbringen. Nur bottom-up sind solche Veränderungen, wenn überhaupt, möglich. Sie sind zu unterstützen in der Hoffnung, dass sie moralisch ansteckend wirken.
Dazu gehören auch positive Zukunftsbilder: Welche Gewinne an Lebensqualität entstehen in einer Gesellschaft, die die natürliche Umwelt erhält? Der Ökonom und Soziologe Albert Hirschman hat in seinen Analysen politischer Bewegungen gezeigt, wie bedeutsam Vorstellungen von einem angestrebten zukünftigen Zustand sind: Sie dienen den Handelnden als Quelle der Motivation für ein aufopferungsvolles Handeln in der Gegenwart, selbst wenn ihnen die Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs bewusst ist.
Zweitens könnten Weiterentwicklungen des Rechtssystems einen Hebel erzeugen. Zwar ist die Natur nach Artikel 20a GG ein schützenswertes Objekt, doch verfügt sie nicht über subjektive, einklagbare Rechte. Im Recht könnte, ähnlich wie bei Unternehmen, die Rechtsfiktion der Natur als juristischer Person geschaffen werden. Dies findet erste Resonanz in der Rechtsprechung. Die Umwelt könnte so eine stärkere Repräsentation erfahren, wenngleich deren Interessen selbstredend von Menschen definiert und artikuliert werden müssten. Über die Bindewirkung des Rechts für das staatliche Handeln könnten langfristige Orientierungen eine stärkere politische Verankerung erfahren.
Und drittens ginge es um die Förderung von Märkten für umweltgerechte Produkte. Unternehmen müssen Investitionen in Ökologie als profitables Geschäftsmodell erkennen können, wobei der Staat diesen Weg regulativ initiiert, finanziell unterstützt und verlässlich durchsetzt – und zugleich für soziale Umverteilung sorgt, um seine Legitimation zu wahren.
Doch was auch immer man anführen mag, der Pessimismus lässt sich nicht ausräumen. Die während der letzten 300 Jahre entstandenen Strukturen der kapitalistischen Moderne zerstören die biologische Nische, in der menschliche Kultur stabil bestehen kann, und verhindern zugleich eine hinreichende Reaktion auf die Krise. Man mag in alternative Welten umziehen wollen. Aber sie stehen nicht bereit. Dass unsere Gesellschaften noch rechtzeitig aus ihrer Lage herausfinden, ist Wunschdenken.
- Link abrufen
- X
- Andere Apps
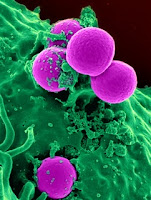

Kommentare
Kommentar veröffentlichen